Unglaublich: Neue Solaranlagen werden künstlich ausgebremst
Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, muss die Schweiz ihre Bemühungen zur Dekarbonisierung dringend vorantreiben. Eine wesentliche Schlüsselrolle übernimmt dabei die Solarenergie, doch der Ausbaupfad ist noch lange nicht auf der Zielgeraden. Eine starke Bremse bilden die finanziellen Rahmenbedingungen für die Solarenergie. Per Anfang 2025 haben viele Gemeinden und lokale Stromversorger die Einspeisevergütung für überschüssigen Solarstrom massiv gesenkt. Das würgt den Zubau neuer PV-Anlagen ab, wie folgendes Beispiel zeigt.

In einer Gemeinde im solothurnischen Aaregäu (Fall ist der Redaktion namentlich bekannt) war eine private 700 Quadratmeter grosse PV-Anlage vorgesehen. Eine Woche vor Einreichung des entsprechenden Gesuchs für den Bau der Anlage vernahmen die Initianten, dass von der örtlichen Stromversorgerin ab 2025 geplant sei, nur noch ein paar wenige Rappen für die Einspeisung des Stroms ins öffentliche Netz zu bezahlen. Bis und mit 2024 hat die örtliche Elektra grosszügige 23 Rappen Einspeisevergütung pro Kilowattstunde (kWh) bezahlt, was natürlich ausserordentlich gut war und zu einem massiven Zubau von PV-Anlagen in der Gemeinde geführt hat. Die Gemeinde war vorbildlich und lobenswert unterwegs. Ja, der hohe Einspeisetarif für Solarstrom galt sogar als Standortvorteil. Dann hat die örtliche Stromversorgerin diesen Standortvorteil mit einem Schlag zunichte gemacht. Mit Änderungen bei der Einspeisevergütung haben zwar alle gerechnet, aber nicht mit einer Senkung von 23 Rappen auf 5-6 Rappen pro kWh an einem einzigen Stichtag.
PV-Anlagenbesitzer fühlen sich an der Nase herumgeführt
PV-Anlagenbesitzer machen nun ziemlich die Faust im Sack, verbünden sich und tauschen sich untereinander aus. Einige klären ab, ob eine solch happige Senkung der Einspeisevergütung von einem Tag auf den anderen, bezüglich Treu und Glauben, überhaupt rechtens sei (Entscheid an der Gemeindeversammlung hin oder her). Denn hinter der Investition für eine bestehende PV-Anlage steht meist ein mehrjähriger Amortisationsplan. Und der geht bei solchen Ertragssprüngen für den Besitzer/die Besitzerin der PV-Anlage mit Sicherheit nicht mehr auf. Auch der Preisüberwacher wurde in dieser Angelegenheit schon angegangen, welcher das Problem kennt, aber nichts tun kann. Denn die gewaltige Preisdifferenz zwischen Strompreis vom öffentlichen Netz und Strom von PV-Anlagen ist politisch gewollt.
Tatsächlich ist es fraglich, warum PV-Besitzer im vorliegenden Fall für ihren überschüssigen Strom vom örtlichen Stromlieferanten nur 5-6 Rappen bekommen, während die selben PV-Besitzer für Strom vom öffentlichen Netz während der gleichen Zeit 22 Rappen an den örtlichen Stromlieferanten bezahlen müssen. Es heisst immer, Strom sei bei schönem Wetter während dem Tag am Markt nichts wert. Doch diese Preisdifferenz hat mit Markt wohl nicht mehr viel zu tun, sondern viel eher mit geschickter Arbeit der Stromlobby im Bundeshaus.
Fakt ist: Eine solche Preispolitik ist Gift für die Bemühungen des Bundes und der Politik für mehr erneuerbare Energie. Die Preispolitik der örtlichen Stromlieferantin hat im vorliegenden Fall logischerweise zum sofortigen Stopp des 700 Quadratmeter grossen Photovoltaik-Projektes geführt. Bei einer Einspeisevergütung von 12-15 Rappen pro kWh wäre die Anlage innert nützlicher Frist amortisierbar gewesen und gebaut worden. Nicht jedoch bei einer Vergütung von nur noch 5-6 Rappen. Da würde der produzierte Strom schlicht verschenkt. Die Initianten der PV-Anlagen haben die Falle erkannt und ihr Geld mittlerweile ertragsreicher investiert. Die Chance auf eine weitere PV-Anlage im Dorf ist auf Jahre hinaus (oder für immer) vertan.
Wahrscheinlich ist das nicht das einzige Photovoltaik-Projekt, welches wegen der Senkung der Einspeisevergütung gestoppt oder auf die lange Bank geschoben wurde. Und die Aaregäuer Gemeinde ist bei weitem auch nicht die einzige Gemeinde, die aufs Minimum geht bei der Einspeisevergütung.
Politik sollte dringend aktiv werden
Das ist schade: Denn Strom wäre doch eigentlich Strom - egal wer ihn produziert. Und jede neue PV-Anlage ist für die örtliche Stromversorgerin wie ein eigenes, kleines Kraftwerk. Produzieren Haushalte mit PV-Anlagen doch rasch 40-70 Prozent ihres Strombedarfs selber und kaufen entsprechend weniger Strom ein. Oder liegt allenfalls genau hier der "Hund" begraben? Werden neue PV-Projekte bewusst abgewürgt, weil die Stromversorger diese langsam als Konkurrenz zu spüren bekommen? Das wäre fatal. Und die Politik sollte hier dringend aktiv werden.
Fakt ist: Solche Riesensprünge von 23 Rappen auf 5-6 Rappen zum Jahreswechsel haben spürbare Folgen für die Amortisationsdauer und einen negativen Effekt auf die Investitionssicherheit. Dadurch wird der Ausbau mit Photovoltaik massiv gehemmt.
Um dies zu verbessern, sieht das Energiegesetz momentan zwar zusätzliche Gefässe wie bspw. die Optimierung des Eigenverbrauches (Kauf eines Speichers / braucht noch mehr Investitionen) oder der Zusammenschluss von Nachbarn zum Eigenverbrauch vor. Diese Möglichkeiten sind für Laien aber nicht einfach zu verstehen und erfordern einen nicht unwesentlichen Zusatzaufwand oder eine Umstellung des Lebens, was viele Interessierte scheuen.

Vorsicht vor zu grossen Anlagen und Investitionen
Die Politik und Stromlobby will offensichtlich, dass zu grosse PV-Anlagen kaum amortisiert werden können. Das ist eine besonders problematische Folge von zu tiefen und flatterhaften Einspeisevergütungen für Solarstrom. Es führt nämlich dazu, dass oft nur einen Teil der zur Verfügung stehenden Dachfläche mit Solarpanels ausgestattet wird, um die Investition tief zu halten und die Amortisation überhaupt erst zu ermöglichen (s. Bild). Einige PV-Besitzer haben es längst erahnt, dass die örtlichen Stromversorger in gewissen Gemeinden zuerst mit hohen Einspeisevergütungen ködern, bis viele PV-Anlagen gebaut sind, um die Einspeisevergütung dann massiv zu senken. Sie haben ihre Anlage nur so gross gebaut, dass sie beidseitig finanziell profitieren können, also wenn die Einspeisevergütung hoch ist (weil sie etwas überschüssigen Strom zu guten Konditionen verkaufen können), oder wenn die öffentlichen Strompreise sinken (weil sie immer Strom vom öffentlichen Stromnetz beziehen). Doch der Dekarbonisierung ist damit kaum gedient. Das ist ein Katz und Maus Spiel.
Von volatilen und niedrigen Rückliefertarifen (Einspeisevergütungen) sind vor allem grössere Produktionsanlagen (also Solaranalagen, die 90-100% des generierten Stroms in das Netz speisen) negativ betroffen: in vielen Fällen werden sie - wie das Beispiel eingangs zeigt - gar nicht erst gebaut. Doch für das Erreichen der Klimaneutralität braucht es eigentlich jeden Quadratmeter Dach- und Fassadenfläche, unabhängig vom Eigenverbrauchsgrad des Nutzers.
Noch einmal: Die Politik wäre gut beraten, die Strompreisdifferenz zwischen verkauftem Solarstrom und eingekauftem Strom vom öffentlichen Netz massiv zu verringern und die Einspeisevergütungen langfristig zu fixieren. Mit dem Markt hat die heutige Preisdifferenz nämlich nichts zu tun, sondern viel eher mit Wucher.
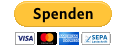





Comments